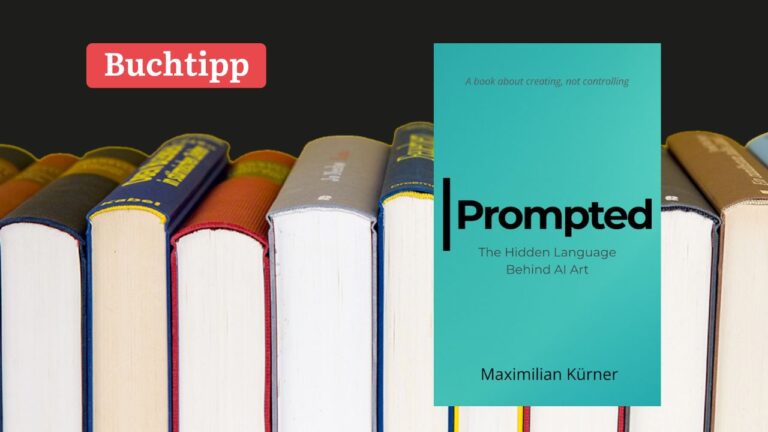Wem können wir noch trauen? Diese Frage stand im Zentrum des iab Business Breakfast am 12. November 2025 in den Meeting Suites by bene. Österreichs größte Interessenvertretung der Digitalwirtschaft widmete sich der Ambivalenz der Mediennutzung zwischen Vertrauen, Verantwortung und Fake News und gewährte erste Einblicke in eine aktuelle INTEGRAL-Studie zum Medienvertrauen der Österreicher. Nach einer Keynote von Bertram Barth (INTEGRAL), die zentrale Erkenntnisse der jüngsten Untersuchung vorstellte, kamen Nana Siebert (Der Standard), Eva Maria Kubin (Cope), iab-austria-Präsidentin Rut Morawetz, Julia Eisner (Women in AI) und Moderator Armin Rogl (MediaBrothers) zu Wort und diskutierten, wie sich Medienvertrauen, Verantwortung und Informationsverhalten im digitalen Zeitalter verändern.
„Das Vertrauen in klassische Medien schwindet zunehmend – zugleich verändert sich die Mediennutzung rasant“, betont Rut Morawetz, Präsidentin des iab austria. „Vor diesem Hintergrund haben wir uns als iab austria in den vergangenen eineinhalb Jahren intensiv mit dem Thema Fake News auseinandergesetzt, stets im konstruktiven Austausch mit Politik und Wirtschaft. Um Wege zu mehr Medienkompetenz und Vertrauen zu diskutieren, fand auf gemeinsame Initiative mit ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti vor Kurzem erst ein Round Table im österreichischen Parlament statt.“
Auf der Suche nach Vertrauen im digitalen Rauschen
Zum Auftakt des Business Breakfast präsentierte Bertram Barth zentrale Ergebnisse der in Zusammenarbeit von INTEGRAL und dem iab austria realisierten, repräsentativen Studie zur Mediennutzung und Vertrauensentwicklung hierzulande. Grundlage der Erhebung bildeten die Sinus-Milieus – ein wissenschaftlich fundiertes Gesellschaftsmodell, welches aus Gruppen von Menschen mit ähnlichen Werten und Lebenshaltungen besteht. Befragt wurden Personen im Alter von 16 bis 75 Jahren.
Deutlich zeigt sich: Der wichtigste Informationskanal bleibt das öffentlich-rechtliche Fernsehen, vor allem in der Altersgruppe der 50- bis 75-Jährigen. Social Media hingegen spielt vor allem bei den 16- bis 29-Jährigen eine zentrale Rolle. Auffällig ist dabei, dass selbst eher traditionelle Milieus wie die „Konservativ-Etablierten“ oder „Nostalgisch-Bürgerlichen“ Social-Media-Plattformen heute ähnlich selbstverständlich nutzen wie die Zukunftsmilieus „Kosmopolitische Individualisten“ oder „Progressive Realisten“.
Beim Vertrauen führt das öffentlich-rechtliche Fernsehen – direkt nach Internetseiten von Behörden – in nahezu allen Milieus. Lediglich in der „Konsumorientierten Basis“ liegt der Anteil unter 50 Prozent. Social Media rangiert hingegen abgeschlagen auf Platz zehn: Nur ein Fünftel der Nutzer vertraut den dort verbreiteten Informationen. Relativ höheres Vertrauen zeigen noch die „Adaptiv-Pragmatische Mitte“, „Hedonisten“ und „Kosmopolitische Individualisten“ – also jene jungen Lifestyle-Perfektionierer, die digitale Inhalte intensiv konsumieren.
Ein Blick auf die Fake-News-Kompetenz offenbart eine starke Ambivalenz: Während 78 Prozent der Befragten den Mitmenschen eine geringe oder gar keine Fähigkeit zur Erkennung von Falschmeldungen zuschreiben, trauen sich zwei Drittel (69 Prozent) selbst zu, Fake News identifizieren zu können. Gleichzeitig gaben 56 Prozent an, bereits mindestens einmal auf Falschinformationen hereingefallen zu sein. Innerhalb der letzten zwölf Monate haben sogar 74 Prozent Desinformationen wahrgenommen – und über alle Milieus hinweg gelten Social-Media-Plattformen als deren wichtigster Verbreitungskanal.
Zur Kontrolle von Desinformation existieren keine einheitlichen, milieu-übergreifenden Lösungen. Während sich breite Zustimmung für die Kennzeichnung von KI-Inhalten sowie für Medienbildung und Qualitätsjournalismus findet – insbesondere in den Leitmilieus–, stoßen Maßnahmen wie staatliche Überwachung, Kontrolle oder verpflichtende Faktenchecks bei systemkritischen Gruppen auf deutliche Ablehnung. Zugleich zeigt sich eine wachsende Verunsicherung: Jeweils die Hälfte der Befragten gab an, digitale Medien heute weniger zu nutzen als früher und oft nicht mehr zu wissen, welchen Informationen sie glauben können.
„Fake News führen zu Verunsicherung, die sich auf die Mediennutzung und Medienwahrnehmung insgesamt negativ auswirken können – besonders im ‚Nostalgisch-Bürgerlichen Milieu‘ und in der von ihm stark beeinflussten ‚Konsumorientieren Basis‘“, fasst Barth zusammen. „Und es gibt die moderne Mitte der ‚Adaptiv-Pragmatischen‘, die auf der Suche nach Orientierung sind – Menschen, die glaubwürdige Medien schätzen und Rat und Unterstützung benötigen.“
Medien zwischen Verantwortung und Veränderung
Wie in der anschließenden Podiumsdiskussion erörtert wurde, liegt eine Herausforderung für Medien vor allem darin, im Überangebot an Informationen journalistische Qualität sichtbar zu machen: „Wir leben in einer Überinformationsgesellschaft – evolutionär reagieren wir auf aufgeregte Inhalte stärker. Die Aufgabe von Journalisten sollte es sein, Ruhe hereinzubringen, weniger zu dramatisieren und dafür umso sorgfältiger zu arbeiten“, so Nana Siebert.
Für Qualitätsmedien sei die Kennzeichnung KI-generierter Inhalte Pflicht, meinte Siebert. Dazu forderte sie einen Ausbau der Medienkompetenz-Workshops für Lehrkräfte.
Eva Maria Kubin machte deutlich, dass das Vertrauen vieler Menschen – nicht zuletzt infolge der Corona-Pandemie – nachhaltig erschüttert sei: „Es gibt nach wie vor Menschen, die meinen, dass klassische Medien ausschließlich politisch gesteuert sind und die generell allem misstrauen. Diese Gruppe wird man schwer erreichen können. Aber ich hoffe in der restlichen Bevölkerung auf eine Gegenbewegung zu der derzeitig global um sich greifenden Abkehr von Fakten. Ich gehe davon aus, dass man auch junge Menschen sehr wohl für Fakten und objektiv recherchierte Inhalte begeistern kann – dafür braucht es in den Redaktionen aber ebenfalls junge Menschen, deren journalistischer Arbeit sie ihr Vertrauen schenken können.“
Auch Rut Morawetz führte an, dass der gesellschaftliche Dialog entscheidend sei. „Auf Social Media präsent zu sein, bedeutet für Medienhäuser einen erheblichen zusätzlichen Aufwand – und viele junge Menschen sind nicht bereit, dafür zu zahlen. Aber Wertschätzung dafür ist da, das zeigt auch die Studie. Gerade deshalb muss Medienförderung weitergedacht werden: Sie bedeutet nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Zuhören, Vernetzen und gegenseitiges Lernen“, erklärte Morawetz. „Zugleich sollten sich Medien bewusst machen, welche Verantwortung mit jedem investierten Werbeeuro einhergeht – denn letztlich trägt jede und jeder einen Teil zur Gestaltung der Medienlandschaft bei.“
Julia Eisner hob die Bedeutung von KI-Kompetenz als integralen Bestandteil von moderner Medienkompetenz hervor: „Viele junge Menschen ahnen kaum, wie stark Algorithmen ihre Wahrnehmung beeinflussen – oder was eine digitale Bubble überhaupt bedeutet“, sagte sie. „Gerade deshalb ist es entscheidend, früh ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was Künstliche Intelligenz kann – und was nicht: zu Hause und in der Schule. Dafür braucht es auch Kompetenzen bei Eltern, Bezugspersonen und Lehrkräften. Zugleich habe ich großes Vertrauen in die junge Generation: Sie will verstehen, kritisch hinterfragen und die digitale Zukunft aktiv mitgestalten.“
„Übertriebene Warnungen vor Social Media bringen nichts – entscheidend ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der rege Andrang und die hohe Beteiligung an der Diskussion machen deutlich, wie groß das Bedürfnis nach Austausch ist und dass Themen wie Desinformation, KI und Glaubwürdigkeit Menschen über Branchengrenzen hinweg bewegen“, fasste Moderator Armin Rogl zusammen.