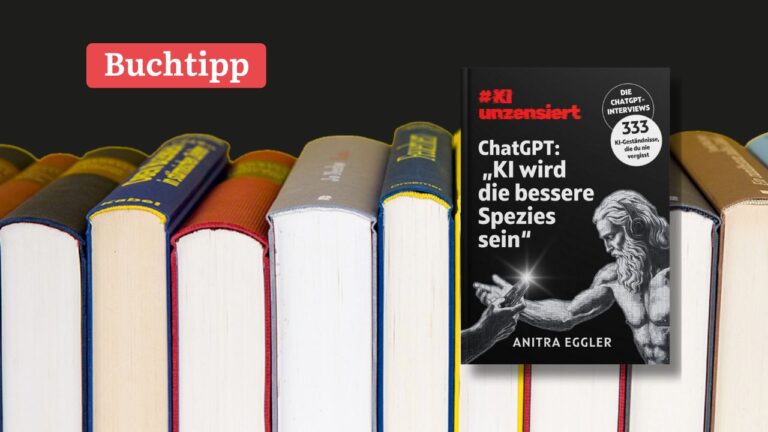Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich erneut mit dem langjährigen Verfahren zwischen dem Axel-Springer-Verlag und der Eyeo GmbH, Entwickler der Werbeblocker-Software Adblock Plus, beschäftigt. Im Zentrum steht diesmal das Urheberrecht. Springer argumentiert, dass der HTML-Code seiner Webseiten durch den Einsatz von Werbeblockern unzulässig verändert und damit in ein urheberrechtlich geschütztes Computerprogramm eingegriffen werde.
Das oberste deutsche Zivilgericht verwies das Verfahren an das Oberlandesgericht Hamburg zurück, da nach seiner Einschätzung wesentliche technische Aspekte bisher nicht ausreichend geprüft wurden. Insbesondere die Rolle von Browsern und deren interne Verarbeitungsschritte – etwa die Umwandlung von Bytecode in Objektcode – sollen nun genauer untersucht werden.
Rechtliche Einordnung der Browsermanipulation
Konkret stützt sich der Verlag auf Paragraf 69c Nr. 2 des Urheberrechtsgesetzes. Dieser schützt Computerprogramme vor unautorisierten Änderungen. Aus Sicht von Axel Springer betrifft dies auch die vom Browser generierten Datenstrukturen, die durch Adblocker manipuliert würden. Die Eyeo GmbH hingegen verweist auf die individuelle Nutzungsperspektive: Nutzerinnen und Nutzer verändern lediglich die Darstellung auf dem eigenen Endgerät – nicht jedoch die Quelle der Inhalte selbst.
Ein Urteil, das die Springer-Position stützt, könnte weit über Werbeblocker hinaus Auswirkungen entfalten. Betroffen wären potenziell alle Browser-Erweiterungen, die in die Darstellung oder Funktion von Webseiten eingreifen – etwa Übersetzungstools, Sicherheits-Add-ons oder barrierefreie Darstellungshilfen.
Zwischen Nutzerinteresse und wirtschaftlichen Interessen
Die Auseinandersetzung reiht sich in eine lange Debatte um die Legitimität von Werbeblockern ein. Während Medienunternehmen ihre Refinanzierung gefährdet sehen, schätzen viele Internetnutzende Adblocker als Instrument zur Wahrung von Privatsphäre, zur Reduktion von Tracking und zur Verbesserung der Ladezeiten.
Mozilla warnt in einem aktuellen Beitrag eindringlich vor den Folgen eines möglichen Verbots. Der Browserhersteller sieht nicht nur den Datenschutz, sondern auch die Innovationsfähigkeit des offenen Webs gefährdet. Deutschland wäre nach China das zweite Land weltweit, das ein derart weitreichendes Verbot umsetzt.
Langfristige Entscheidung offen
Sollte das Gericht dem urheberrechtlichen Argument folgen, könnten Werbeblocker aus App-Stores entfernt oder von Browsern gelöscht werden müssen. Auch wenn technisch versierte Nutzerinnen und Nutzer weiterhin Umgehungslösungen finden würden, wäre der flächendeckende Einsatz solcher Software deutlich erschwert.
Die Entscheidung in Hamburg wird mit Spannung erwartet, da sie nicht nur das Verhältnis zwischen Plattformen, Werbetreibenden und Nutzenden neu definieren könnte, sondern auch europaweite Signalwirkung entfalten dürfte. Mit einem abschließenden Urteil ist frühestens in ein bis zwei Jahren zu rechnen.