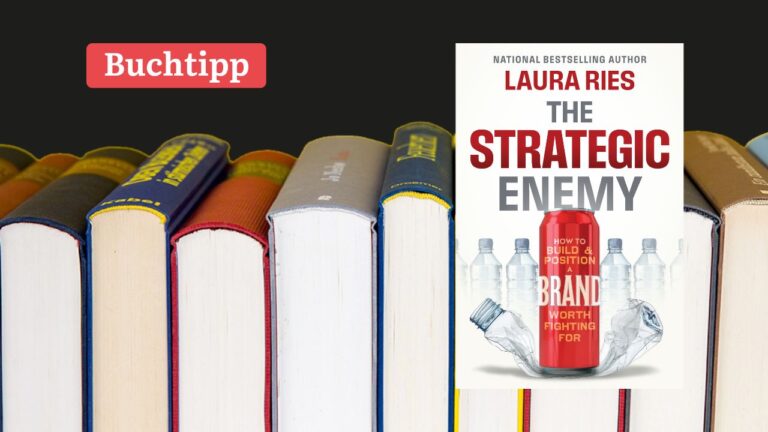„Grundsätzlich stehen Soziale Netzwerke ab einem bestimmten Alter jeder/jedem offen. Jedoch müssen die Nutzungsbestimmungen des jeweiligen Netzwerks berücksichtigt werden“, heißt es auf der Website www.oesterreich.gv.at des Bundeskanzleramts. Damit beginnt auch schon das Dilemma. Und die Verwirrung. Denn während viele Plattformen ein Mindestalter von 13 Jahren vorgeben, gilt in Österreich für die selbstständige Anmeldung in Sozialen Netzwerken ein Mindestalter von 14 Jahren.
Doch jetzt droht ein Social-Media-Verbot bis 15 Jahre. Darauf scheint sich zumindest die Bundesregierung geeinigt zu haben. Auch Justizministerin Anna Sporrer (SP) hat sich in diversen Interviews und Stellungnahmen für diese Altersgrenze ausgesprochen. „Wir dürfen unsere Kinder nicht an das Internet verlieren“, meint sie beispielsweise im „profil“ vom 5. Juli 2025.
Bei dieser jüngsten Verbotsdebatte, ausgelöst durch das schreckliche Schul-Attentat in Graz, zeigt sich wieder einmal, dass sie weitgehend eindimensional geführt wird. Neue Grenzen setzen. Neue Verbote einführen. Eine neue Altersgrenze festlegen – willkürlich. Den Zugang einschränken. Das ist es. Auf diese Themen bleibt die – und deswegen auch sehr österreichische – Diskussion weitgehend beschränkt.
Ähnliches hat sich und zeigt sich immer noch bei den Debatten rund um die Künstliche Intelligenz und ein Verbot im Unterreicht sowie beim Verbot von Mobiltelefonen an Schulen. Verbieten. Punkt. Ende der Durchsage. Aus. Nur ganz leise, nur weit abgesetzt flackern sehr vereinzelt Stimmen auf, die sich den Themen mit einem breiteren, umfassenderen Blick nähern. Ein holistischer Zugang bleibt ohnedies meist aus.
Auch bei der Debatte um eine neue und gesetzlich fixierte Altersgrenze für den Zugang zu digitalen Netzwerken bleibt ein breiteres Themenspektrum weitgehend ausgespart. Kaum ein didaktischer Diskurs. Nichts von einer Debatte zu generell mehr Sozial-Media-Kompetenz. Kein Beitrag zu mehr Medien-Bildung an unseren Schulen – schon gar nicht zu Sozial Media. Dafür taucht mit garantierter Zuverlässigkeit wieder das Argument auf, dass diese Medien-Kompetenz ohnedies im schulischen Gesamtangebot und von jedem einzelnen Lehrer, jeder einzelnen Lehrerin vermittelt werden soll. Und bleibt damit so schwammig und nichtssagend wie eh und je.
Abgesehen davon, dass die sozialen Medienplattformen mittlerweile seit rund zwei Jahrzehnten zu unserem Leben gehören, zeigen viele gesellschaftliche, soziale und andere Entwicklungen eine klar gegensätzliche Tendenz zum Hinaufschrauben von Altersgrenzen und neuen Zugangshürden. Da sind beispielsweise die immer lauter werdenden Rufe nach einem Herabsetzen des Alters für die Strafmündigkeit. Doch es bedarf gar nicht dieser Extremforderung.
Kinder dürfen in Österreich ab 12 Jahren mit einem Fahrrad, aber auch mit einem E‑Scooter am öffentlichen Verkehr teilnehmen. Letzteres zudem ohne jegliche Schulung und Versicherung. Jugendliche dürfen mittlerweile mit 15 Jahren ein Moped fahren – dazu genügt eine schlichte Einwilligung der Eltern. Nach nur weiteren sechs Monaten an Lebensalter dürfen sie mit einer L17-Führerscheinausbildung beginnen und ab dem 17. Lebensjahr nach bestandener L17-Prüfung mit einem Führerschein der Klasse B unbegleitet ein Auto lenken. Aber auch das Wahlalter wurde auf 16 Jahr herabgesetzt.
Zu all dem gesellt sich, dass wir den Kids in der Schule und im jugendlichen Alltag immer mehr zumuten und abverlangen. Aber den Umgang mit Sozial Media, wahrscheinlich das wichtigste und am weitesten verbreitet Ausdrucksmittel und Kommunikationsinstrument der Gegenwart, wollen wir ihnen, den Digital Natives und nun auch KI-Natives, weitgehend verbieten.
Nur damit jene Geister, die von KI, Internet und Social Media vielfach keine Ahnung haben, beruhigt sind. Und: Damit wir uns eine umfassende inhaltliche, soziologische, bildungspolitische, wirtschaftliche und und und Debatte ersparen.