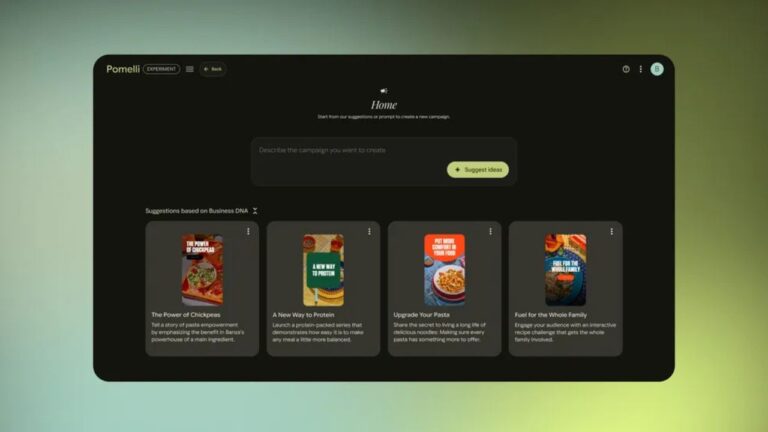Ein Eichkätzchen-Baby fällt aus dem Netz, blutet und wird schließlich gerettet. Tiere, je pelziger und je putziger, kommen beim Publikum immer gut an. Das besagt eine alte Medienweisheit. Das haben sich vermutlich auch die (Online)-Redakteur:innen der „Zeit im Bild” gedacht. Sie rückten die rührselige Geschichte vom blutendem, letztendlich aber wundersam geretteten kleinen Nager in ihre Themenliste und publizierten sie unter dem „ZIB“-Logo auf Social Media.
Darf das sein? Nein! Zumindest dann nicht, wenn es um die Relevanz und damit auch um die Glaubwürdigkeit eines Mediums geht. Die „Zeit im Bild” ist nicht nur die Nachrichtensendung des ORF, sondern nach wie vor die wichtigste Nachrichten- und damit einer der größten Medien-Marken des Landes. Neben der Berichterstattung zu nationalen und internationalen Ereignissen zählen entsprechend hohe journalistischen Standards, das Aufzeigen von Zusammenhängen und Hintergründen, Objektivität, Genauigkeit und Relevanz zum Anspruch eines solchen Leit- und Qualitätsmediums. Als solches ist die „ZIB”, der ORF als öffentlich-rechtlicher Sender insgesamt einzuordnen.
Das junge Eichkatzerl und seine Geschichte sind eine glückliche Fügung des Schicksals, ein erfreuliches chronikales Ereignis, ein positiver Akzent in der allgemein negativen Nachrichtenlage. Es handelt sich aber auch um ein zutiefst lokales Vorkommnis, das nicht einmal mehr regional von Bedeutung ist. Ein netter, bunter Tupfen für ein Lokalblatt. Aber kein Thema für die größte Nachrichten-Marke des Landes. Egal, auf welcher medialen Plattform diese auch ausgespielt wird.
Das herzige Eichkatzerl und die „ZIB” stehen aber auch beispielhaft für eine Entwicklung, die sich immer mehr ausbreitet, je mehr die diversen Medienhäuser und ihre Marken in den sozialen Medien um Aufmerksamkeit ringen. Da werden vielfach alle thematischen und markentechnischen Schranken niedergerießen, die Hürden für einen glaubwürdigen, relevanten Journalismus möglichst tief angesetzt.
Das flauschige Eichkatzerl ist längst nicht allein. Es steht vielmehr für die extreme Verwässerung journalistischer Qualitätskriterien. Beispielsweise berichtet ein namhaftes Computermagazin auf Social Media immer wieder über Unternehmen, die in die Pleite schlittern. Nicht aus der Computer- oder Software-Branche, sondern über Autohäuser, Restaurants und Cafés. Klassische Themen für die Lokalberichterstattung, die in solchen Fällen allerdings via Social Media in die weite Welt hinausgeblasen werden. Da versteigt sich u.a. ein Informationsdienst für die Kommunikationsbranche zu einer Reportage vom Wiener Diversity Ball. Nicht einmal dann thematisch zur Marke passend, wenn auf dem gesellschaftlichen Ereignis heftigst getrascht und geklatscht wurde. Aber die Klickrate rechtfertig mittlerweile jeden inhaltlichen Ausflug.
Von der Tageszeitung über Nachrichtenmagazine bis hin zu Fachmedien und dem Fernsehen stehen sowohl auf dem Publikums- als auch auf dem Werbemarkt alle unter gehörigem Druck. Social Media-Plattformen haben sich – unabhängig von der inhaltlichen Qualität von News und Infos – längst zu ihrer größten Konkurrenz aufgeschwungen, bieten den etablierten Media-Marken aber auch die Chance, ihre bestehenden Zielgruppen in neuer Form und bisher nicht erreichte Userinnen und User für sich zu gewinnen.
Klickraten zählen in diesem sich verschärfenden Wettbewerb zwar zu einer allseits anerkannten Währung, doch darf der Fokus nicht ausschließlich auf sie gerichtet sein. Wer Relevanz und thematisch konzise Berichterstattung deswegen zu sehr aus dem Auge verliert, die eigene Marke zu sehr verwässert, verliert letztendlich an Relevanz, Glaubwürdigkeit und damit auf lange Sicht auch Leser:innen, Seher:innen, Hörer:innen und am Ende auch User:innen.